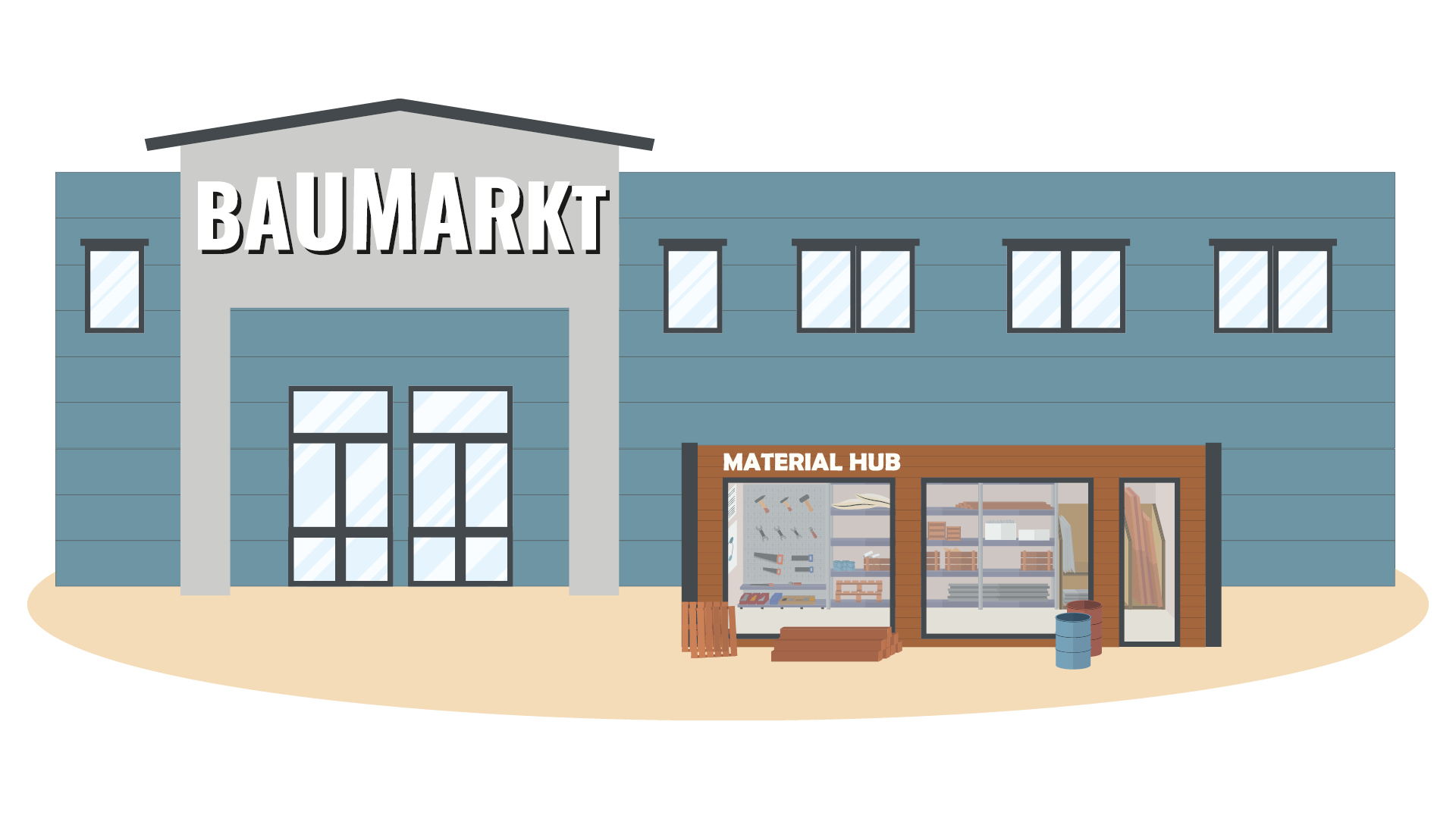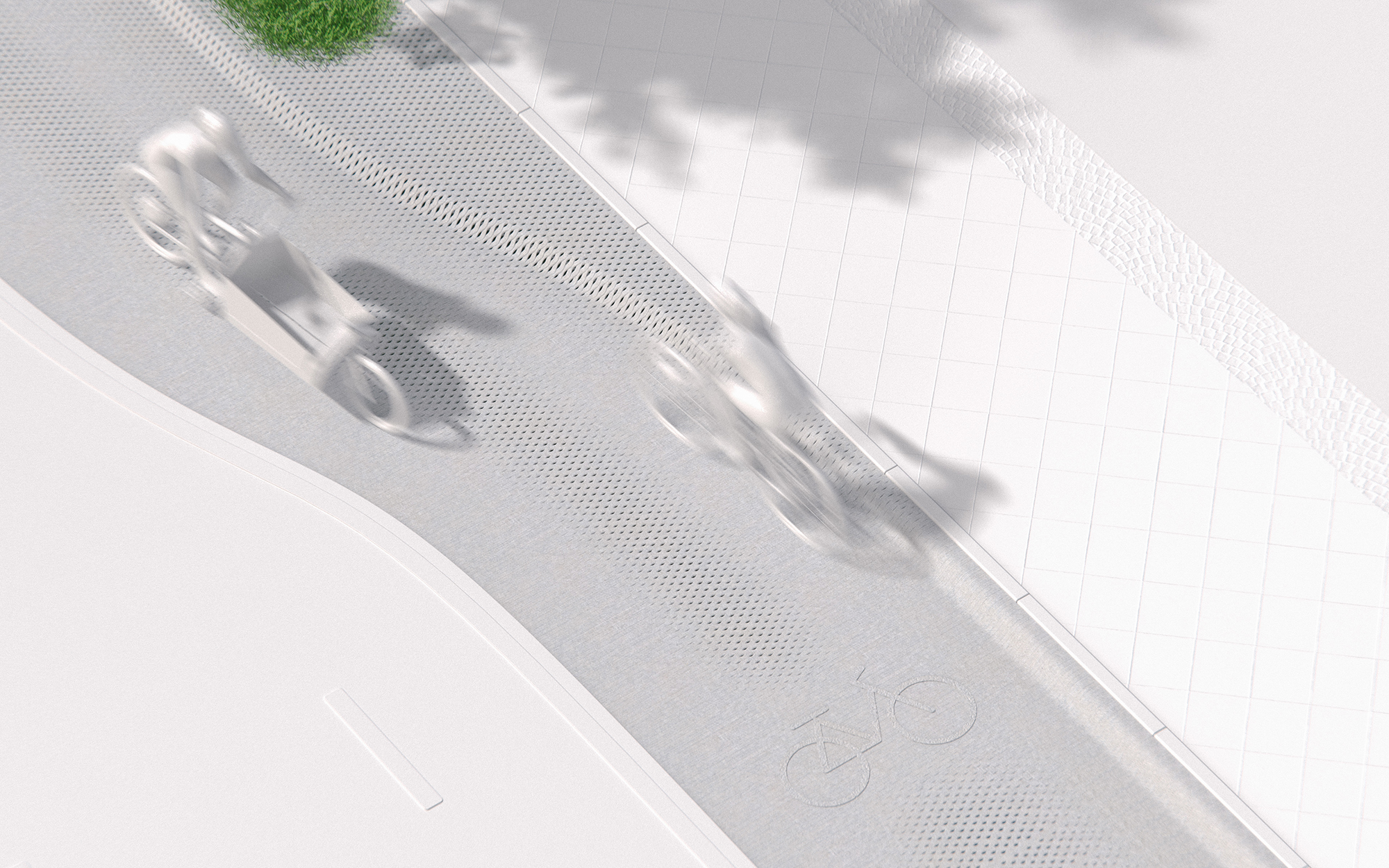Der „Material Hub“ ist eine Ort, an dem Menschen gebrauchte Materialien abgeben und erwerben können. Der Hub soll in Kooperation mit dem Baumarkt in dessen unmittelbarer Nähe eingerichtet werden, um ein möglichst niedrigschwelliges und ergänzendes Angebot zu bieten. Dadurch soll das Ziel erreicht werden, die Wiederverwendung von gebrauchten Materialien sowie Kreislaufdenken und -handeln alltäglich zu machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, informiert der Hub gleichzeitig über weitere nachhaltige Anlaufstellen oder Events von lokalen Akteur*innen wie etwa Upcycling Designer*innen. Gleichzeitig bietet der Hub diesen Akteur*innen die Möglichkeit, ein Ort für Veranstaltungen zu sein, um sich beispielsweise co-kreativ und gestalterisch mit Themen wie nachhaltigem Design oder Circular Economy auseinanderzusetzen. So schafft der „Material Hub“ einen allgegenwärtigen Raum für Kreislaufdenken und -handeln und motiviert Besucher*innen, dies in ihrem individuellen Nutzungsverhalten zu etablieren.