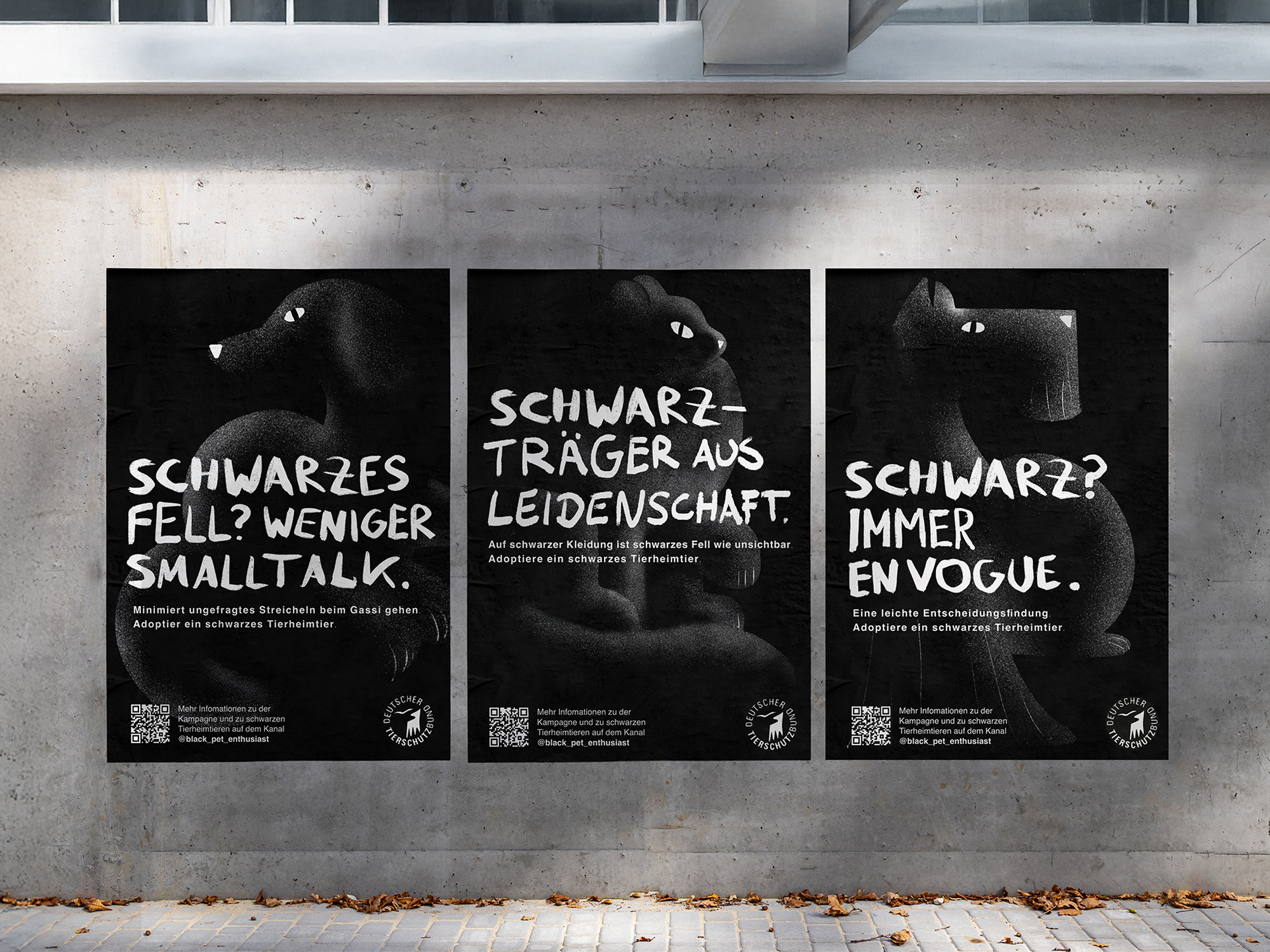„Nimm sie beim ersten Date mit ins Schwimmbad …“ – dieser Satz aus einem Meme zeigt, wie tief gesellschaftlicher Druck rund um Make-up sitzt. Die Bachelorarbeit untersucht Make-up als Ausdrucksmittel jenseits oberflächlicher Schönheitsideale. Im Fokus steht eine kritische Auseinandersetzung mit normativen Erwartungen, sozialem Druck und der ambivalenten Rolle von Kosmetik im Alltag. Warum wird Make-up oft mit Oberflächlichkeit, Täuschung oder Unsicherheit verbunden?
Basierend auf theoretischen Analysen, Umfragen und Workshops wurde ein interaktives Spiel entwickelt, das Make-up als Mittel des Empowerments nutzt. Für 2–8 Spieler*innen fördert es durch kreative Aufgaben, Fragen und Austausch Reflexion und neue Perspektiven. „Beyond“ steht dabei für das Denken über das Sichtbare hinaus – eine gestalterische Einladung zur Auseinandersetzung mit Identität, Diversität und gesellschaftlichen Normen.