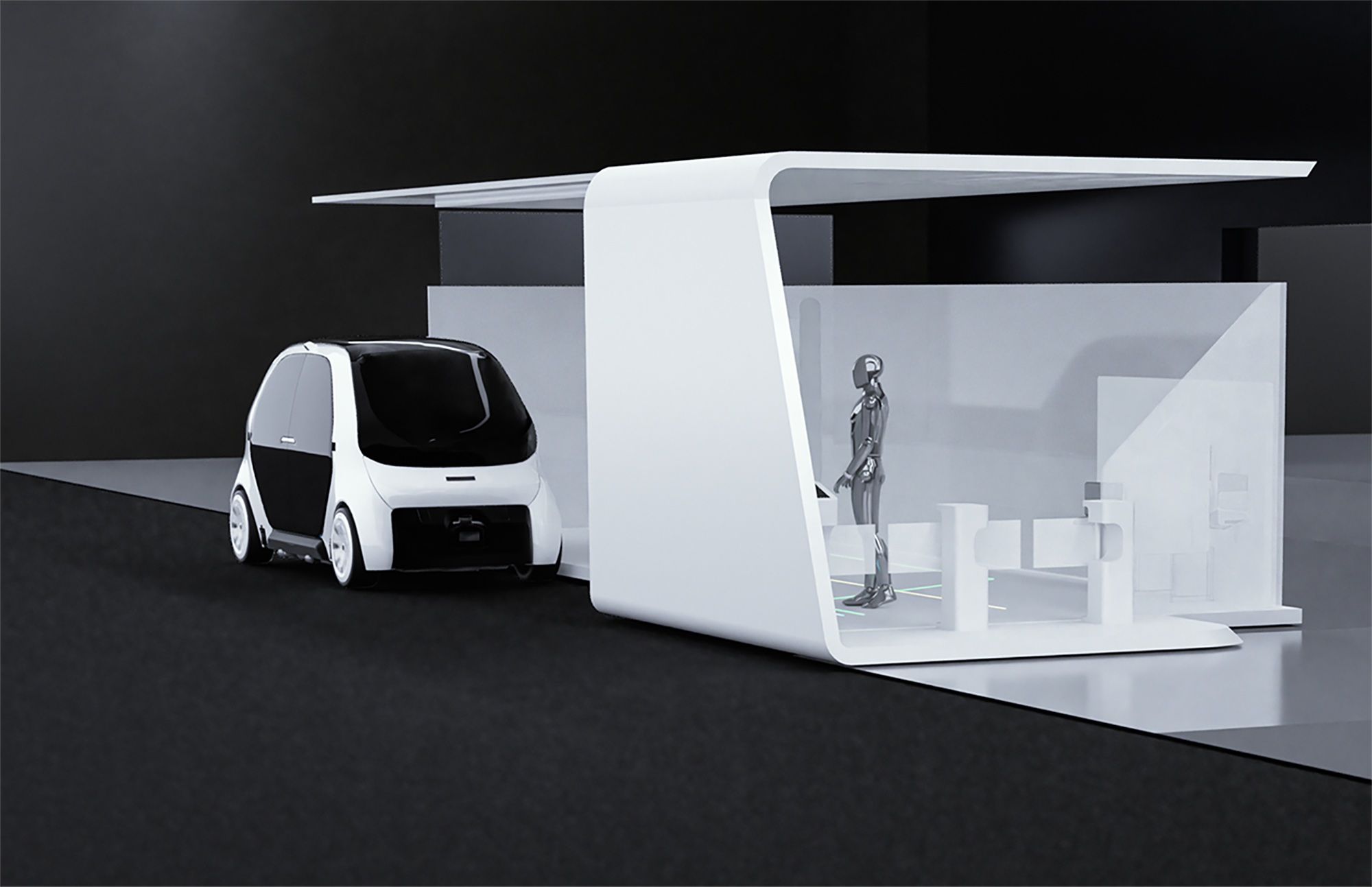Die Verunreinigung durch Mikroplastik stellt ein globales Gesundheitsrisiko dar. Die Kunststoffpartikel gelangen über den Wasserkreislauf in die Nahrungskette. Den größten Teil der Mikroplastikverschmutzung machen Kunststofftextilfasern aus dem Abwasser von Waschmaschinen aus.
Es gilt eine hygienische, benutzerfreundliche Lösung zu finden, die ohne Wegwerfteile auskommt und es erlaubt, den Bestand an filterlosen Waschmaschinen nachzurüsten. Dabei muss die Lösung kompatibel mit der Pumpleistung der Waschmaschinen sein und verstopfungsfrei arbeiten, also besonders wartungsarm funktionieren.
“mo” ist eine Zentrifuge, die Mikropartikel aus Waschmaschinenabwasser filtert. Wird mo an die Waschmaschine angeschlossen, gelangt das Abwasser vorgereinigt in die Kanalisation. Das Filtrat wird nach jedem Waschgang gepresst und in einem Fach gesammelt, sodass Nutzer*innen es kontaktlos über den Hausmüll entsorgen können. Somit ist mo eine verbraucher*innenfreundliche und saubere Lösung, die verhindert, dass die Umwelt durch Textilfasern belastet wird.