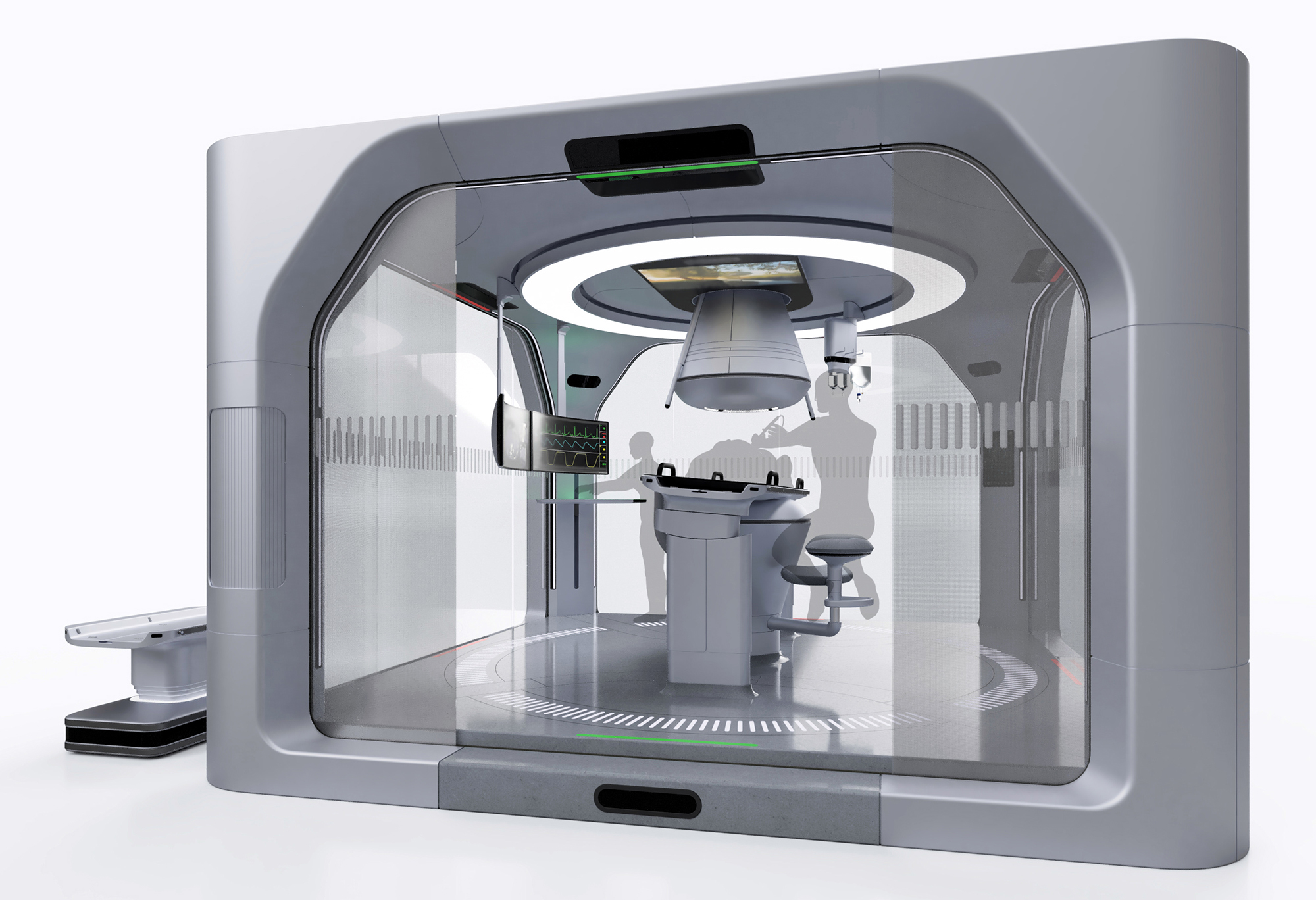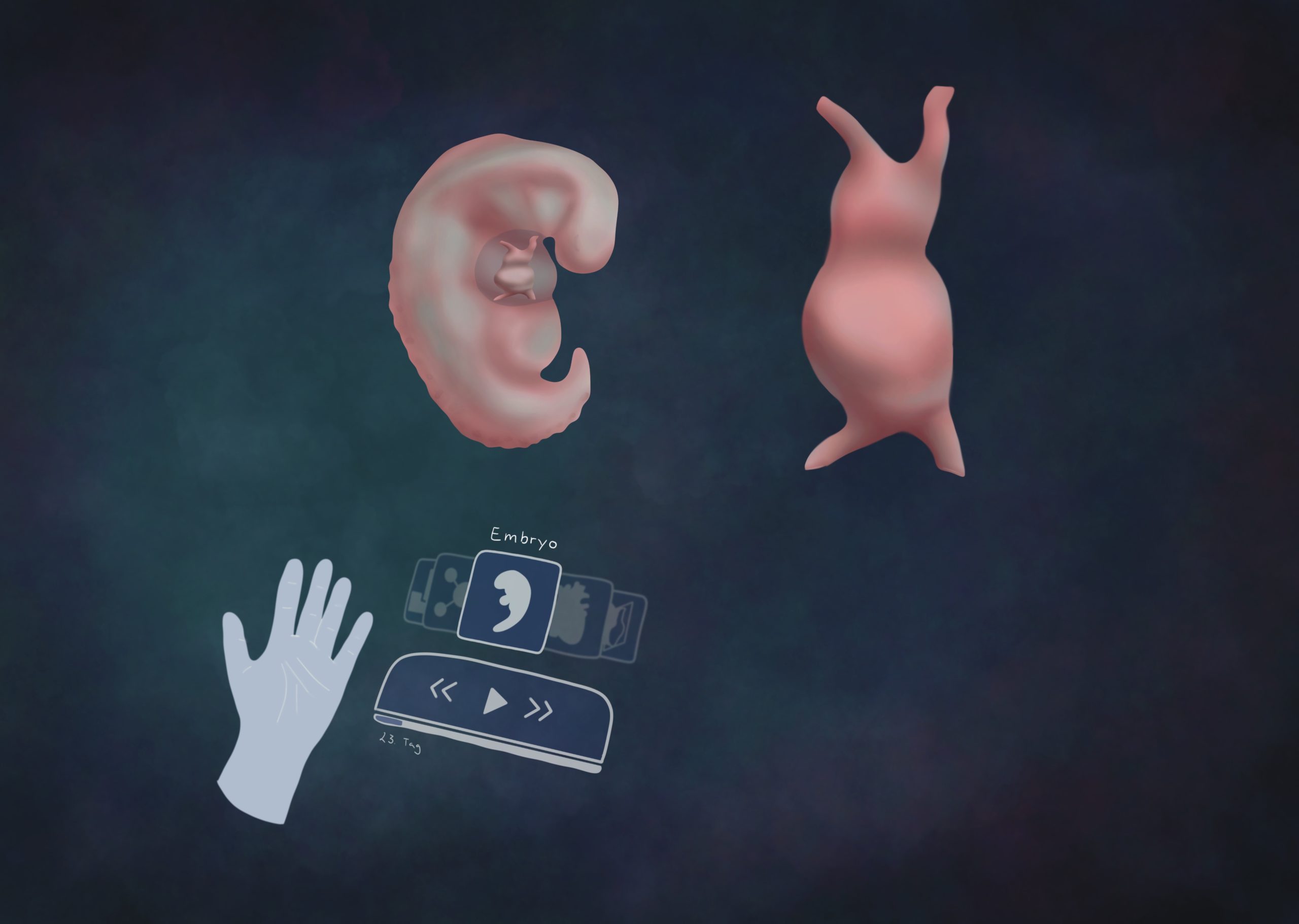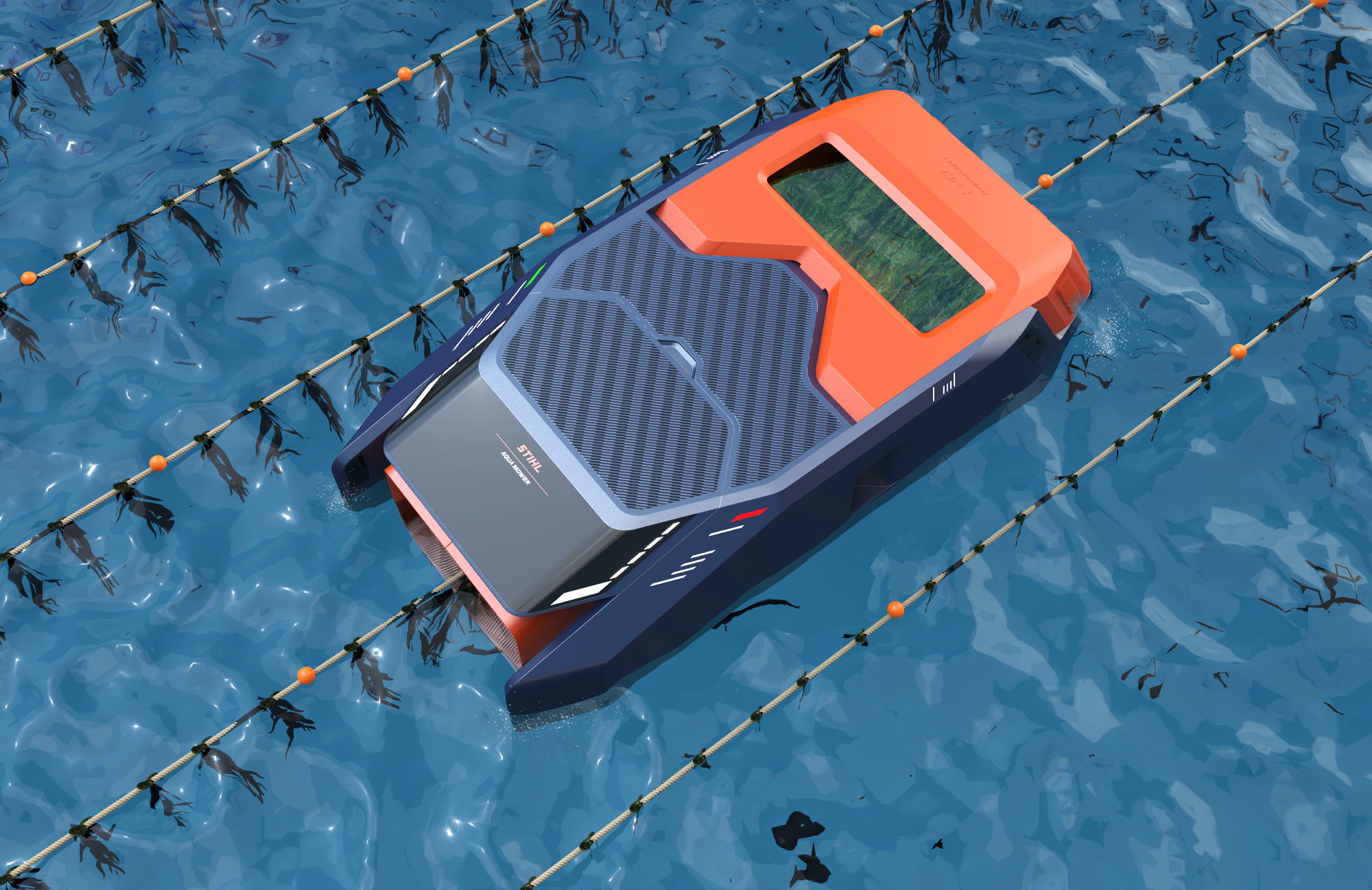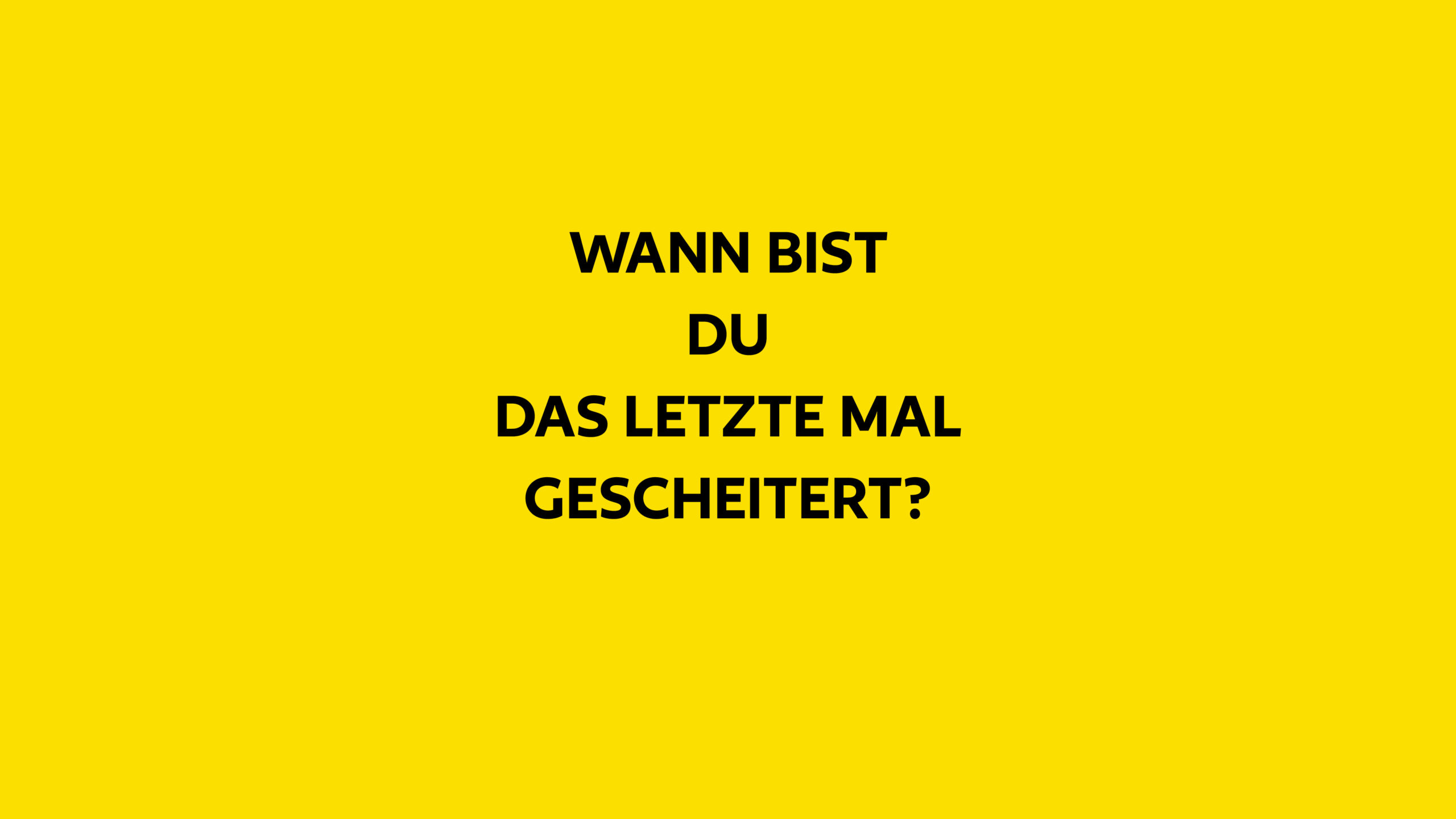NightLink ist ein Konzept, das Nachtzüge als zukunftsfähiges und nachhaltiges Transportmittel weiterentwickelt. Die Auswirkungen auf Umwelt und Klima machen das Fliegen auf Kurz- und Mittelstrecken in Europa immer unattraktiver. Eine sehr gute Alternative zu Auto und Flugzeug stellen Nachtzüge dar, da sie hohen Komfort mit klimafreundlichem Reisen verbinden können. Doch gerade an Komfort mangelt es den heute eingesetzten Nachtzügen auf dem Weg zu einem attraktiven Alltagstransportmittel.
Das Projekt NightLink beschäftigt sich damit, wie ein moderner Nachtzug für eine große Gruppe von Menschen attraktiv, komfortabel und zugänglich gestaltet werden kann und dabei gleichzeitig ökonomisch und ökologisch funktional bleibt.